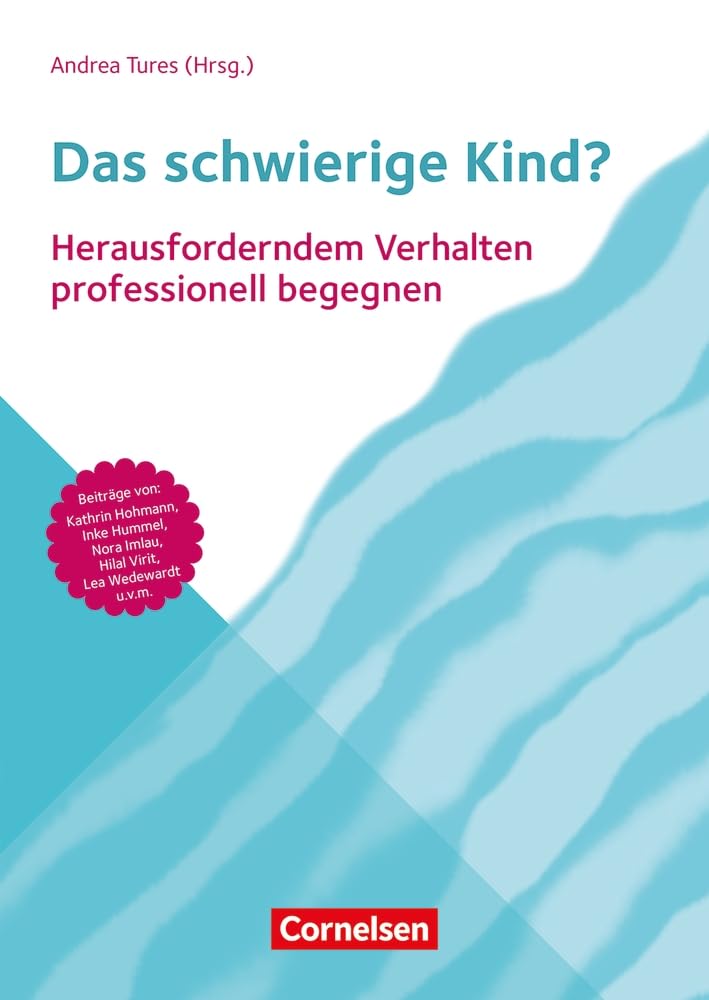Dieser Beitrag enthält einen Buchlink zum Partnerprogramm
Als Mama von zwei Kindern – eines davon hochsensibel und mit weiteren Diagnosen – und gleichzeitig als langjährige Pädagogin im Elementarbereich habe ich viele Bücher gelesen, in der Hoffnung, das „ver-rückte“ Verhalten meines Kindes besser zu verstehen und pädagogisch fundiert darauf reagieren zu können. Schon in meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass verrückt von verrücken kommt – also an einer anderen Stelle stehen, als man es auf den ersten Blick denkt. Was mir im pädagogischen Alltag leichter fällt, ist beim eigenen Kind für mich herrausfordernd. Das schwierige Kind war eines dieser Bücher – und es hat mich tief bewegt, bereichert und in vielen Punkten auch herausgefordert.
Schon der Titel des Buches provoziert: Das schwierige Kind – ein Begriff, den ich im Alltag oft höre, aber versuche zu vermeiden. Doch schnell wird beim Lesen klar: Der Begriff dient als Türöffner für eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem, was wir in Pädagogik und Elternschaft allzu oft als „Problemverhalten“ etikettieren. Das Buch führt weg von vorschnellen Diagnosen und hin zu einer respektvollen, beziehungsorientierten Haltung.
Ein neuer Blick auf kindliches Verhalten
Die Autor*innen – ein interdisziplinäres Team aus Psychologie, Pädagogik und Entwicklungswissenschaft – zeigen eindrucksvoll, dass kindliches Verhalten immer ein Ausdruck innerer Zustände ist. Was wir als „schwierig“ empfinden, ist häufig ein Ruf nach Verbindung, ein Ausdruck von Überforderung oder schlicht ein Entwicklungsschritt, der Raum und Begleitung braucht. Das Kind, das wütend tobt, verweigert oder ständig „dazwischenfunkt“, ist kein Störenfried – es ist ein Kind, das uns etwas mitteilen möchte.
Besonders hilfreich fand ich die wiederholte Betonung, dass Verhalten kontextabhängig ist: Kinder sind nicht per se schwierig – sie geraten in Schwierigkeiten. Ein Kind mit ADHS beispielsweise zeigt oft kein auffälliges Verhalten, wenn es sich verstanden, sicher und reguliert fühlt. Erst in einem Umfeld, das diese Regulation nicht mitträgt oder aufrechterhält, werden die Symptome zum Problem. Dieser systemische Blick ist für mich als Mutter und Fachkraft gleichermaßen befreiend wie motivierend.
Bindung, Regulation und Co-Regulation als Schlüsselbegriffe
Zentral ist die Rolle der Beziehung. Das schwierige Kind betont, dass Entwicklung in und durch Beziehung geschieht. Besonders eindrücklich ist das Kapitel zur Co-Regulation: Kinder lernen Selbstregulation nicht durch Strafen oder Grenzsetzung im klassischen Sinne, sondern durch einfühlsame Erwachsene, die ihnen in stürmischen Momenten zur Seite stehen. Für mein Kind mit ADHS war das ein Wendepunkt: Als ich begann, sein Verhalten nicht mehr als „Absicht“ oder „Ungehorsam“ zu interpretieren, sondern als Ausdruck eines überfluteten Nervensystems, veränderte sich unser Umgang grundlegend. Nicht über Nacht, aber spürbar.
Die Autor*innen erklären neurobiologische Grundlagen zugänglich und praxisnah. Besonders die Beschreibungen zur Funktion der Amygdala, zur Rolle von Spiegelneuronen und zur Stressverarbeitung im kindlichen Gehirn haben mir geholfen, viele alltägliche Situationen neu zu begreifen. Ich wünschte, dieses Wissen wäre Bestandteil jeder pädagogischen Ausbildung – und jedes Elternführerscheins, wenn es so etwas gäbe.
Konkrete Hilfestellungen und Fallbeispiele
Trotz der theoretischen Tiefe bleibt das Buch alltagstauglich. Es enthält zahlreiche Fallbeispiele, die sich nicht nur auf Schulsituationen beschränken, sondern auch Alltagsszenen zu Hause oder in der Kita einbeziehen. Das macht die Lektüre lebendig und praxisnah. Besonders wohltuend finde ich, dass auf „Erziehungstipps“ im klassischen Sinne verzichtet wird. Stattdessen geht es um Haltung, um Beziehungspflege, um die Fähigkeit zur Selbstreflexion als erwachsene Bezugsperson.
Die vorgeschlagenen Strategien reichen von der Gestaltung eines sicheren Rahmens bis zur bewussten Selbstfürsorge – ein Punkt, den ich als Mutter eines hochsensiblen Kindes besonders wichtig finde. Denn oft geraten wir als Eltern selbst an unsere Grenzen. Das Buch erinnert uns daran, dass auch wir Unterstützung brauchen – und dass das nichts mit Versagen zu tun hat, sondern mit Menschlichkeit.
Ein Appell an unsere Gesellschaft
Das schwierige Kind ist nicht nur ein Fachbuch, sondern auch ein gesellschaftspolitisches Plädoyer. Die Autor*innen fordern mehr Achtsamkeit in Bildung und Betreuung, weniger Druck auf Kinder, mehr Ressourcen für individuelle Begleitung. Sie machen deutlich: Kinderverhalten ist kein „Fehlverhalten“, das ausgemerzt werden muss, sondern ein Entwicklungssignal, das gehört und verstanden werden will.
Gerade in einer Leistungsgesellschaft, die früh mit Normen und Bewertungen arbeitet, braucht es solche Stimmen, die für Vielfalt, für kindliche Würde und für das Recht auf „anders sein“ eintreten. Als Mutter, die oft um das Verständnis für ihr Kind kämpfen muss – beim Arzt, in der Kita, auf dem Spielplatz – fühle ich mich durch dieses Buch gesehen und gestärkt.
Fazit: Ein Buch, das berührt, bildet und befreit
Das schwierige Kind ist kein Buch, das man einmal liest und dann ins Regal stellt. Es ist ein Arbeitsbuch für Herz und Verstand, ein Nachschlagewerk für Krisenmomente und ein Mutmacher für alle, die mit Kindern leben oder arbeiten, die „aus der Reihe tanzen“. Vor allen Dimgen ist es aber auch ein Fahbuch – das für wissentschaftliche Srbeiten genutzt werden kann und sollte.
Für mich als Pädagogin war es eine fachliche Vertiefung – für mich als Mutter eine emotionale Entlastung. Ich wünsche mir, dass dieses Buch viele Hände erreicht. Es schenkt uns nicht nur ein tieferes Verständnis für Kinder, sondern auch für uns selbst.